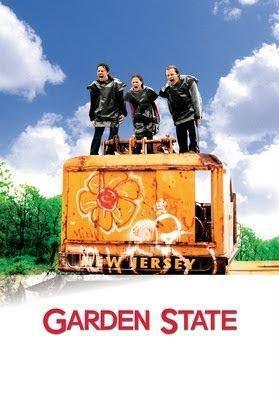"Es gibt ein paar Kindheitserfahrungen, die ich irgendwie verpasst hab." -- "Es gibt ein paar Kindheitserfahrungen, die ich gerne verpasst hätte"
Zuletzt haben wir hier über Irreversibel gesprochen – einen Film, der einem den Magen umdreht, einem den Schlaf raubt und die Welt für ein paar Stunden düster und hoffnungslos erscheinen lässt.
Deshalb dachte ich mir: Es wird Zeit für etwas Schönes. Für einen Film, der das Herz wärmt, der zum Schmunzeln bringt und der einen an diese kleinen, manchmal unscheinbaren Dinge im Leben erinnert, die am Ende vielleicht doch das Allerwichtigste sind. Und da kommt Garden State von und mit Zach Braff genau richtig. Ein Film, der im Kern nichts anderes ist als eine zarte Umarmung – melancholisch, ja, aber auch voller Leben, voller Hoffnung und voller Musik, die man danach nicht mehr vergessen kann.
Die Fakten: Erscheinungsjahr: 2004, Genre: Tragikomödie / Coming-of-Age, Laufzeit: 102 Minuten, FSK: 12
Die Story: Andrew Largeman ist ein junger, mäßig erfolgreicher Schauspieler, der seit Jahren in Los Angeles lebt und mit einer ordentlichen Portion Antidepressiva durchs Leben stolpert. Als sein Vater ihn zum Tod seiner Mutter zurück nach New Jersey ruft, kehrt Andrew in seine alte Heimat zurück – ein Ort voller Kindheitserinnerungen, alter Freunde und unausgesprochener Konflikte. Dort trifft er auf Sam, ein quirliges, unkonventionelles Mädchen, das ihm Stück für Stück zeigt, dass man das Leben nicht betäubt, sondern fühlen muss – mit all seinen Höhen, Tiefen, Absurditäten und Schmerzen.
Garden State ist einer dieser Filme, die man kaum beschreiben kann, ohne dass es kitschig klingt – und die trotzdem alles richtig machen. Zach Braff hat hier mit seinem Regiedebüt einen Ton getroffen, der genau zwischen Melancholie und Lebensfreude balanciert. Andrew ist ein typischer Protagonist der "Lost Generation" der frühen 2000er: entfremdet, betäubt, in sich selbst gefangen. Aber anstatt uns mit einem weiteren "Mann findet sich selbst"-Plot zu langweilen, schenkt der Film Momente, die so ehrlich, so bizarr und so witzig sind, dass man gar nicht anders kann, als mitzugehen.
Ein Highlight – und das ist schwer zu übersehen – ist die Musik. Braff kuratierte den Soundtrack selbst, und der wurde damals mit einem Grammy ausgezeichnet. The Shins, Simon & Garfunkel, Iron & Wine – das sind keine bloßen Hintergrundgeräusche, sondern eine zweite Erzählebene, die den Film trägt. "You gotta hear this song, it’ll change your life" sagt Sam an einer Stelle, und genau das passiert: Man hat das Gefühl, dass einen die Musik durch Andrews emotionalen Weg begleitet, ja, manchmal sogar mehr erklärt als die Dialoge.
Besonders schön ist, dass Garden State nie ins Zynische abgleitet. Natürlich, es gibt Schmerz, Trauer, auch diese merkwürdige Lähmung, die viele Anfang 20 kennen, wenn die Welt zu groß und das eigene Leben zu leer wirkt. Aber der Film glaubt an die Möglichkeit, dass Begegnungen etwas verändern können. Dass ein Mensch, ein Gespräch, ein Lied, ein verrückter Moment im Regen reicht, um etwas in Bewegung zu setzen.
Natürlich könnte man sagen, dass der Film ein bisschen zu sehr im Indie-Hipster-Kitsch der Nullerjahre badet. Natalie Portman ist fast schon zu perfekt als quirky Dreamgirl, manche Dialoge schrammen haarscharf am Pathos vorbei. Aber das macht nichts. Denn Garden State ist so aufrichtig, so verspielt und so liebevoll gemacht, dass man ihm das einfach verzeiht.
Für mich ist es einer dieser Filme, die man immer wieder mal herausholt, wenn man etwas Leichtes, Schönes, Beruhigendes braucht. Kein Meisterwerk im klassischen Sinne, kein Kino, das die Regeln neu schreibt. Aber ein Film, der einem sagt: Hey, das Leben ist vielleicht chaotisch, traurig, verrückt – aber es lohnt sich, es zu fühlen.
Herzlichst Sebastian